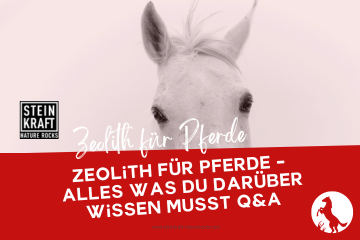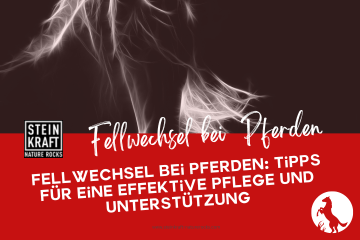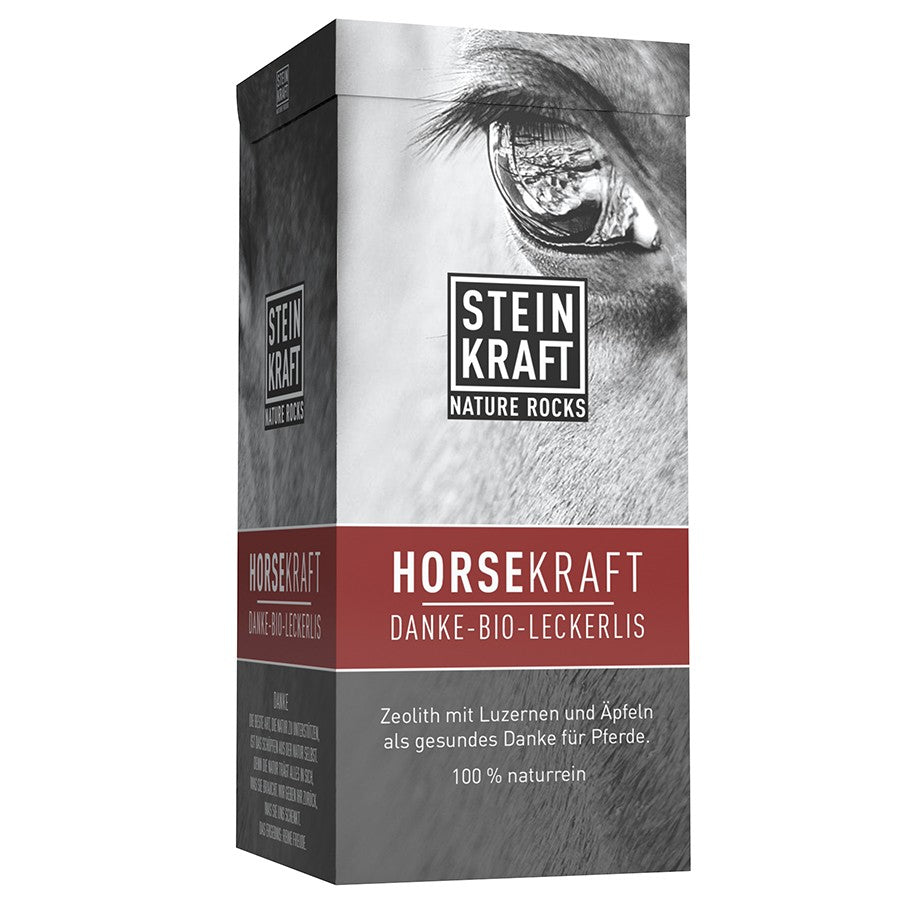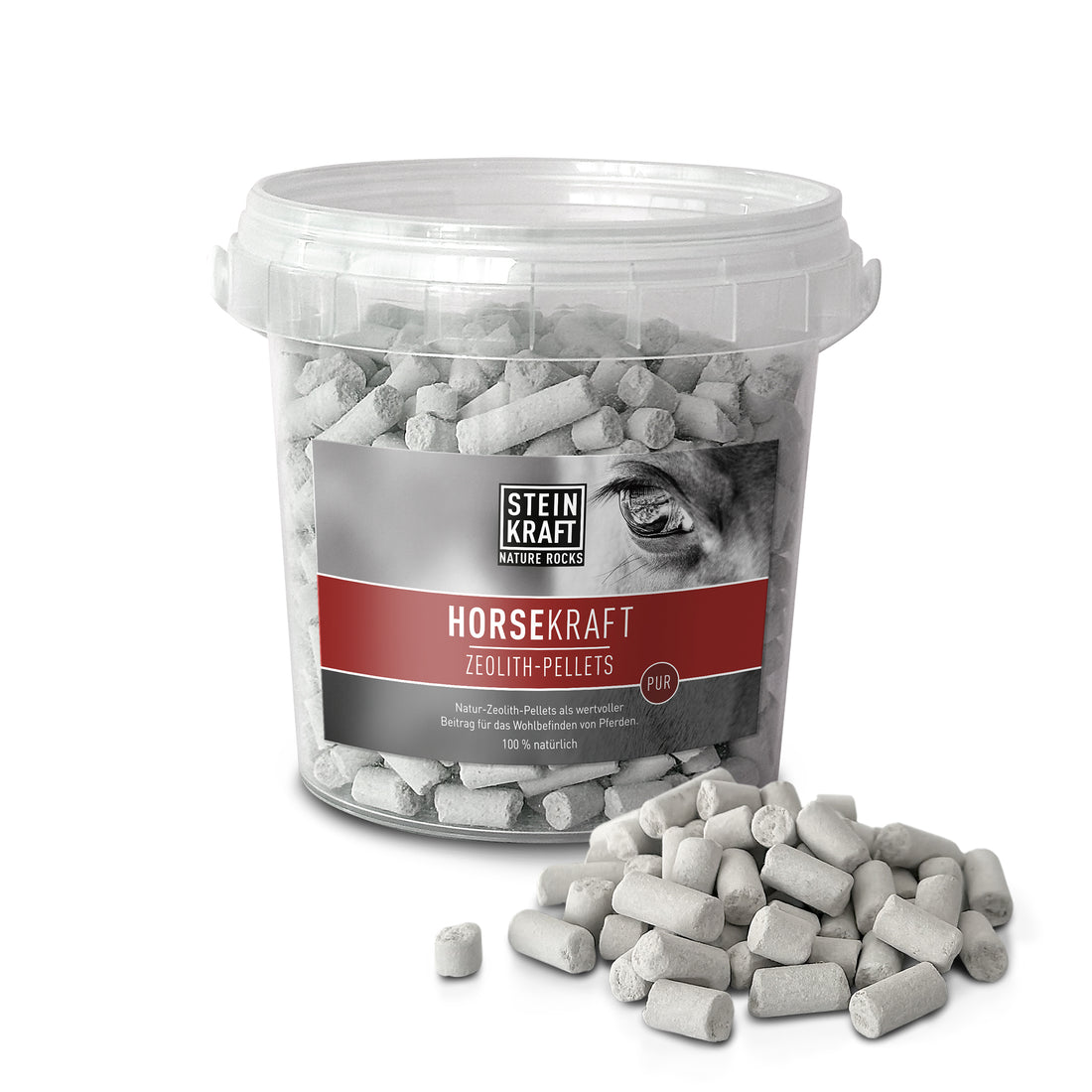Pferde im Frühling haben immer wieder spezielle Herausforderungen
Der Frühling ist eine wundervolle Jahreszeit – die Tage werden länger, die Sonne gewinnt an Kraft und überall beginnt es zu grünen. Für uns Pferdehalter und unsere Vierbeiner bringt diese Zeit neue Energie und Lebensfreude, aber auch einige Herausforderungen mit sich. Der Wechsel von Winter zu Frühjahr bedeutet Wetterumschwung, Temperaturschwankungen und biologische Veränderungen im Pferdekörper. An einem Tag kann es schon angenehm warm sein, am nächsten fegen kalter Wind und Regen über den Hof. Dieses Auf und Ab des Wetters fordert den Pferdeorganismus heraus: Das Immunsystem muss sich an veränderte Bedingungen anpassen, der Stoffwechsel stellt sich um und im Pferdekörper laufen jetzt wichtige Prozesse auf Hochtouren. Dennoch ist der Frühling auch eine Zeit des Aufbruchs – viele Pferde spüren den Jahreszeitenwechsel und reagieren mit sichtbarer Lebensfreude. In diesem Blogartikel schauen wir uns die wichtigsten Frühlings-Themen rund ums Pferd an. Wir beginnen mit allgemeinen Aspekten des Jahreszeitenwechsels und widmen uns dann speziellen Bereichen: vom Fellwechsel über die Fütterungsanpassung bis hin zu Weidegang, Allergien und dem veränderten Verhalten. Dazu gibt es praktische Tipps, damit du dein Pferd optimal auf die Frühlingszeit vorbereiten kannst. Abschließend laden einige Reflexionsfragen dazu ein, die eigene Pferdepflege und das Management im Frühling zu überdenken und anzupassen.
Fellwechsel: Wenn der Winterpelz geht
Mit den ersten warmen Tagen beginnt bei Pferden der Fellwechsel. Oft machen sich schon im Januar oder Februar die ersten Haare locker – still und leise startet der Körper den Wechsel vom dichten Winterpelz zum kurzen Sommerfell.
Was für uns wie ein endloses Bürsten und Haare sammeln wirkt, ist für das Pferd eine echte Höchstleistungdes Stoffwechsels. Der gesamte Organismus ist im Aufruhr, denn innerhalb weniger Wochen wächst ein komplett neues Haarkleid. In dieser Zeit hat der Körper „alle Hufe voll zu tun“ und viele Pferde wirken etwas müde oder brauchen extra Unterstützung. Ältere Pferde oder solche mit geschwächtem Organismus fallen im Fellwechsel besonders auf: Sie haaren langsamer ab und tun sich oft schwerer. Tatsächlich besteht gerade in der Fellwechsel-Phase für Pferde ein erhöhtes Risiko für gesundheitliche Probleme, von geschwächtem Immunsystem bis zu Bewegungsstörungen. Wenn das Pferd nährstoffmäßig schlecht versorgt ist oder an Vorerkrankungen leidet, kann der Fellwechsel Folgeprobleme wie Hautekzeme, Husten (Bronchitis) oder Mauke und Allergien nach sich ziehen. Kein Wunder, dass viele Pferdehalter etwas besorgt auf diese Phase blicken.

Zum Glück gibt es einiges, was wir tun können, um den Fellwechsel zu erleichtern. Intensive Fellpflege steht jetzt an erster Stelle: Tägliches gründliches Striegeln und Bürsten hilft deinem Pferd, die losen Winterhaare loszuwerden. Das regt gleichzeitig die Durchblutung der Haut an und unterstützt das Wachstum des glänzenden Sommerfells. Viele Pferde genießen diese Wellness-Einheiten richtig, denn das Jucken durch die lose Wolle wird gelindert. Achte darauf, dass dein Pferd beim Wechsel nicht zu sehr schwitzt oder friert: An warmen Märztagen kann ein dichter Pelz schnell zu Hitzestau führen, während in kalten Nächten abgehaarte Stellen empfindlich sein können. Hier ist ggf. kreatives Management gefragt – etwa eine leichte Decke für geschorene oder sehr früh schon „nackige“ Pferde in kalten Nächten, oder am Tag ein Abschwitzen nach dem Training, damit ein schwitziges Fell nicht auskühlt.
Auch ernährungsphysiologisch braucht das Pferd jetzt Unterstützung. Für die Bildung eines neuen Fells werden zusätzliche Nährstoffe benötigt, zum Beispiel Proteine, Mineralstoffe und Spurenelemente wie Zink und Kupfer (wichtig für Haut und Haar) sowie essentielle Fettsäuren. In freier Natur würde das Pferd diese Bausteine über frisches Frühjahrsgras aufnehmen. Doch oft ist das Gras zu Beginn des Fellwechsels noch kaum gewachsen – die Weidesaison hat noch nicht richtig begonnen. Dadurch fehlt es dem Pferd mitunter an Omega-3-Fettsäuren und anderen ungesättigten Fettsäuren, die für gesundes Fell und Haut wichtig sind. Ein Mangel kann zu trockenem, glanzlosem Fell, Hautproblemen und sogar schlechter Hufqualität führen. Daher kann es sinnvoll sein, zusätzliches Öl oder Leinsamen ins Futter zu geben, um diese Fettsäuren bereitzustellen. Viele Pferde profitieren im Fellwechsel auch von einem hochwertigen Mineralfutter oder speziellen Fellwechsel-Supplementen, die z.B. Bierhefe (für die Darmflora) oder bestimmte Aminosäuren enthalten. Achte aber darauf, nicht einfach wild zu kombinieren – passe die Ergänzungen gezielt an den Bedarf deines Pferdes an und halte im Zweifel Rücksprache mit einem Fütterungsexperten oder Tierarzt.
Kurz gesagt: Geduld und Pflege sind im Frühling das A und O. Unterstütze dein Pferd mit liebevoller Putzhilfe und guter Fütterung, dann wird es den haarigen Umbruch gut meistern. Sollte ein Pferd übrigens gar nicht oder nur sehr unvollständig sein Winterfell verlieren, ist das ein Warnsignal – hier könnte z.B. das Cushing-Syndrom (ECS) dahinterstecken. In solchen Fällen lieber den Tierarzt draufschauen lassen. Für die meisten Pferde jedoch gilt: Mit etwas Extra-Aufmerksamkeit kommen sie gut durch den Fellwechsel und belohnen uns schon bald mit glänzendem Sommerfell.
Fütterungsanpassungen im Frühjahr
Der Frühling stellt auch unsere Fütterungspläne auf den Kopf. Ernährungstechnisch passiert jetzt ein großer Wandel: Nach einem Winter mit Heu, Silage und vielleicht Rüben oder Mash kommt nun wieder frisches Grün ins Spiel. Die ersten Grasbüschel sprießen und mit jedem Tag wird die Weide nahrhafter. Diese Umstellung bedeutet: Vom energieärmeren, rohfaserreichen Winterfutter geht es hin zu eiweiß- und zuckerreichem Frühlingsgras – und das ist für die Verdauung eine Herausforderung. Denn die Mikroorganismen im Pferdedarm, die für die Futterfermentation zuständig sind, müssen sich erst an das neue Futterangebot gewöhnen .
Im Winter waren vor allem Heu-verdauende Bakterien aktiv; frisches Gras erfordert aber andere Helferlein im Darm. Wenn der Wechsel zu abrupt erfolgt, gerät die Darmflora aus dem Gleichgewicht. Die Folgen: Durchfall, Kotwasser, Koliken – und im schlimmsten Fall sogar Vergiftungserscheinungen oder Hufrehe. Deshalb ist es enorm wichtig, die Fütterung im Frühjahr schrittweise umzustellen und nichts zu überstürzen.

Die größte Umstellung betrifft natürlich die Weidefütterung (dazu gleich mehr im nächsten Abschnitt). Doch auch unabhängig vom Weidegang solltest du im Frühling ein wachsames Auge auf den Futterplan deines Pferdes haben. Prüfe, ob die bisherige Ration noch passt: Viele Pferde benötigen jetzt weniger Kraftfutter, wenn sie reichhaltiges Frühlingsgras fressen können, weil dieses viel Energie liefert. Gleichzeitig sollte man aber nicht von heute auf morgen alle Zusatzfutter streichen – jedes neue oder reduzierte Futter sollte langsam angepasst werden. Wenn dein Pferd im Winter beispielsweise extra Rübenschnitzel oder Hafer bekommen hat, reduziere diese Mengen nach und nach, anstatt sie schlagartig wegzulassen. Andersherum gilt: Willst du im Frühjahr ein neues Ergänzungsfutter (vielleicht für den Fellwechsel) hinzufügen, führe es in kleinen Dosen ein, damit sich die Verdauung darauf einstellen kann.
Ein wichtiger Punkt ist die Raufutterversorgung. Auch wenn das Gras zu sprießen beginnt, darfst du nicht sofort das Heu komplett absetzen. Pferde brauchen strukturreiche Rohfaser fürs Wohlbefinden und für einen gesunden Darm. Zudem ist junges Gras oft noch sehr wasserhaltig und eiweißreich, aber relativ rohfaserarm. Heu bleibt also weiterhin ein wichtiger Teil der Ration, insbesondere solange die Weiden noch nicht voll tragen. Viele Experten empfehlen, vor dem Weidegang Heu zu füttern, damit die Pferde nicht mit völlig leerem Magen auf die Weide kommen. Ich finde diese Idee sehr gut. Ein halbwegs „sattes“ Pferd frisst auf der Koppel langsamer und weniger gierig – das beugt ebenfalls Verdauungsproblemen vor. Dieser Trick ist einfach und effektiv: Gib deinem Pferd eine Portion Heu, ehe es ins frische Grün geht, so ist der erste Hunger gestillt und die Grasaufnahme erfolgt moderater. Nie hungrig einkaufen gehen - passt doch da gut dazu.
Neben der Energie muss auch die Vitamin- und Mineralstoffversorgung betrachtet werden. Frühlingsgras enthält oft reichlich Beta-Carotin (Vitamin-A-Vorstufe) und Vitamin E sowie natürlich viel Vitamin C durch frische Kräuter. Allerdings können einige Mineralien im Boden knapp sein – je nach Region sind Weiden z.B. selenarm oder haben ein ungünstiges Calcium-Phosphor-Verhältnis. Achte daher darauf, dass dein Pferd weiterhin Zugang zu einem Mineralleckstein hat oder ein passendes Mineralfutter bekommt. So vermeidest du schleichende Mängel, die die Gesundheit langfristig beeinträchtigen könnten. Auch Salz (als Salzleckstein) ist wichtig, da Pferde im Frühjahr mit steigenden Temperaturen wieder mehr schwitzen.
Zusammengefasst: Plane die Futterumstellung mit Bedacht. Lass deinem Pferd und seiner Darmflora Zeit, sich an die neue Frühlingskost zu gewöhnen. Behalte das Gewicht deines Pferdes im Auge – viele neigen im Frühjahr zu Wohlstandsbäuchlein, wenn sie plötzlich im Schlaraffenland „Grüne Wiese“ stehen. Passe die Rationen an, aber vermeide radikale Sprünge. Dein Pferd wird es dir mit Gesundheit und Zufriedenheit danken.
Weidegang im Frühling: Frisches Gras mit Vorsicht genießen
Für viele Pferde gibt es nichts Schöneres, als endlich wieder auf die Weide zu dürfen. Nach den oft begrenzten Auslaufmöglichkeiten im Winter bedeutet der Weidegang im Frühling pure Freude: saftiges Gras, Platz zum Galoppieren und Spielen, Sonne auf dem Fell und soziale Kontakte in der Herde. Die Vorteile von regelmäßigem Weidegang sind enorm: Die Pferde bewegen sich den ganzen Tag über frei, was Muskeln und Gelenken guttut. Sie können ihr natürliches Grazing-Verhalten ausleben – also über Stunden kleine Mengen Gras zupfen – was der Psyche und dem Magen-Darm-Trakt entspricht. Frische Luft und Sonnenlicht fördern zudem die Vitamin-D-Bildung und das allgemeine Wohlbefinden. Man könnte sagen, Weidezeit ist Glückszeit für viele Pferde.
Allerdings birgt das junge Frühlingsgras auch Risiken, insbesondere wenn Pferde unvorbereitet und unbegrenzt darauf losgelassen werden. Das frische Grün strotzt vor Fruktan (Zucker), Proteinen und leicht verdaulichen Kohlenhydraten. Pferde neigen dazu, sich nach dem Winter richtig den Bauch vollzuschlagen, wenn man sie lässt – und genau das kann sie krank machen. Ohne langsames Gewöhnen endet der erste ausgiebige Weidegang nicht selten mit Durchfall, Koliken oder sogar Hufrehe. Im Extremfall kann eine solche Futter-Ausschweifung sogar tödlich enden. Jahr für Jahr passieren im Frühjahr leider Fälle von Hufrehe, weil Pferde zu schnell zu viel Gras fressen dürfen. Hufrehe ist eine schmerzhafte Entzündung der Huflederhaut, oft ausgelöst durch übermäßige Aufnahme von wasserlöslichen Kohlenhydraten (wie Fruktan) im Gras. Besonders Ponys, leichtfuttrige Rassen und Pferde mit Vorerkrankungen wie EMS (Equines Metabolisches Syndrom) oder Cushing sind gefährdet. Auch Pferde, die über den Winter etwas moppelig geworden sind, sollten jetzt nicht unkontrolliert auf fetter Weide stehen.
Die gute Nachricht: Mit dem richtigen Management kann dein Pferd die Weide in vollen Zügen genießen und gesund bleiben. Das Zauberwort heißt “Anweiden”. Damit ist gemeint, die Weidezeit schrittweise zu steigern, damit sich Darmflora und Stoffwechsel an das Gras anpassen können. Plane mindestens zwei, besser drei bis vier Wochen für das Anweiden ein. In der ersten Woche genügen z.B. 15 Minuten Weidegang pro Tag, in der zweiten Woche etwa 30 Minuten. Anschließend kann man auf eine Stunde pro Tag erhöhen und dann die Dauer weiter kontinuierlich verlängern. Diese kurzen Weidezeiten am Anfang wirken vielleicht geizig, aber sie sind der Gesundheit deines Pferdes zuliebe. Du kannst dein Pferd anfangs auch angeführt grasen lassen, damit es langsam frisst und du die Kontrolle über die Zeit behältst.
Wichtig: Auch wenn das Wetter schon traumhaft ist und dein Pferd am liebsten stundenlang in der Wiese bleiben würde – bleib konsequent. Es geht darum, schlimme Folgen zu verhindern. Jeder zusätzliche Tag langsamen Anweidens stärkt die Fähigkeit des Pferdekörpers, mit dem Gras umzugehen.
Ein weiterer Tipp ist, wie oben erwähnt, das Pferd nicht hungrig auf die Weide zu schicken. Gib vorher ausreichend Heu, damit der erste Heißhunger gebremst ist. So wird das Gras nicht in Rekordzeit inhaliert, sondern gemütlicher gefressen. Beobachte dein Pferd während der Anweidephase genau: Bekommt es weichen Kot? Bläht sich der Bauch ungewöhnlich? Zeigt es Unlust oder gar Schmerzen (Koliksymptome) nach dem Grasen? Das sind Zeichen, dass du eventuell einen Gang zurückschalten musst mit der Weidezeit. Im Zweifel ziehe rechtzeitig den Tierarzt hinzu, bevor es ernst wird.
Neben dem Anweiden gibt es noch weitere Aspekte des Gras- und Weidemanagements im Frühling. Die Weide selbstbenötigt Pflege: Kontrolliere die Zäune, entferne giftige Pflanzen (die im Frühling sprießen könnten, z.B. Jakobskreuzkraut im frühen Stadium) und achte auf die Bodenverhältnisse. Frühling kann auch Schlechtwetter bedeuten – aufgeweichte Böden und Matschecken. Um die Grasnarbe zu schonen, lasse Pferde besser nicht auf völlig durchnässte Koppeln, oder begrenze die Bewegung dort (z.B. nur Schritt auf matschigem Paddock und Galopp erst, wenn es abgetrocknet ist). So hast du den ganzen Sommer mehr von einer intakten Weide.
Für Pferde mit starkem Übergewicht oder Hufrehe-Risiko kann es sinnvoll sein, die Weidezeit dauerhaft zu begrenzen, auch nach dem Anweiden. In solchen Fällen helfen Stoffwechselkuren (nach Absprache mit dem Tierarzt) oder pragmatische Lösungen wie ein Fressschutz (Grasfangsack bzw. Maulkorb), um die Grasaufnahme zu reduzieren. Das sieht zwar ungewohnt aus, ermöglicht dem Pferd aber trotzdem den sozialen Kontakt und die Bewegung auf der Weide, ohne dass es sich überfrisst. Ebenfalls kann man auf zeitenweisen Weideentzug setzen, z.B. die Pferde über Mittag auf einen abgetrennten Paddock stellen, wenn der Fruktangehalt im Gras am höchsten ist. Fruktan sammelt sich typischerweise bei Sonnenschein in den Gräsern an und wird über Nacht abgebaut – ein Rehe-gefährdetes Pferd lässt man daher eher früh morgens grasen als am späten Nachmittag. Nach frostigen Nächten sollte man empfindliche Pferde ebenfalls erst am Nachmittag weiden lassen, weil gefrorenes Gras sehr viel Zucker enthält.
Trotz aller Vorsicht: Vergiss nicht die positiven Effekte des Weidegangs! Dein Pferd wird es dir danken, wenn es sich wälzen, rennen und mit seinen Kumpels grasen darf. Die frische Bewegung hält die Gelenke geschmeidig, beugt Verspannungen vor und hilft auch beim Fellwechsel (Muskelbewegung regt den Haarwechsel an). Die Sonne kurbelt die Vitamin-D-Produktion an, was für Knochen und Immunsystem wichtig ist. Und last but not least: Ein glückliches Pferd auf der Weide macht doch auch uns Reitern das Herz warm. ?
Also: genieße den Frühling, aber mit Umsicht. Dann bleibt die Weidesaison für alle eine gesunde Freude.
Allergien und Atemwegsprobleme im Frühjahr
So schön der Frühling ist – für manche Pferde bringt er auch allergische Beschwerden mit sich. Genau wie wir Menschen können Pferde auf Pollenflug reagieren. Wenn Bäume und Gräser blühen, liegen allerlei Pollen in der Luft, die bei empfindlichen Pferden zu Atemwegsproblemen oder Hautreaktionen führen können. Husten, Nasenausfluss, häufiger Niesen oder sogar Headshaking (Kopfschütteln) können Anzeichen einer Pollenallergie sein. Tierärzte nennen diese Form oft atopische Dermatitis oder umweltbedingte Allergie, je nachdem ob vor allem die Haut oder die Atemwege betroffen sind. Häufige Allergene im Frühjahr sind Pollen von Bäumen wie Birke oder Eiche, später auch Gräser- und Kräuterpollen, außerdem Schimmelpilzsporen (die in feucht-warmem Wetter auftreten) und Staubmilben – letztere finden sich leider auch im Stall und im Heu. All diese Allergene, die beim Menschen Heuschnupfen und Asthma auslösen, können auch bei Pferden Allergien verursachen. Die Symptome zeigen sich dann entweder an der Haut (Juckreiz, Quaddeln, nässende Ekzeme) oder an den Atemorganen(Husten, erschwerte Atmung).
Ein spezielles Thema – das allerdings meist etwas später im Frühjahr und im Sommer seinen Höhepunkt hat – ist das Sommerekzem. Dabei handelt es sich um eine allergische Reaktion auf Insektenstiche, vor allem die von kleinen stechenden Mücken (Gnitzen der Gattung Culicoides). Tatsächlich ist die Insektenallergie die häufigste Allergieform beim Pferd, und das Sommerekzem (auch „Sweet Itch“ genannt) ein bekanntes Leid vieler Pferde, besonders Islandpferde und Robustrassen. Bereits ab April/Mai, wenn die ersten Insekten aktiv werden, fangen betroffene Pferde an, sich heftig zu scheuern – Mähne, Schweifrübe und Bauchnaht werden wund gerieben durch den starken Juckreiz. Auch Bremsen, Kriebelmücken und andere stechende Plagegeister können Allergien verstärken. Neben Hautproblemen können Insekten im Frühjahr auch Augenentzündungen verursachen (durch Fliegen an den Augen) oder generell Unruhe und Stress bei den Pferden hervorrufen.
Was kannst du als Pferdebesitzer tun, um Allergien und Atemwegsprobleme im Frühling zu managen? Zunächst einmal: Beobachte dein Pferd. Hat es jedes Frühjahr Husten, wenn die ersten Büsche blühen? Oder kratzt es sich verstärkt im April? Solche wiederkehrenden Muster deuten auf saisonale Auslöser hin. Im Falle von Staub und Schimmel kannst du versuchen, die Umgebung deines Pferdes allergenärmer zu gestalten: Jetzt, wo es wärmer wird, kann man z.B. vermehrt lüften, um staubige Stallluft zu verbessern. Beim Stallausmisten sollte das Pferd möglichst nicht im dicken Staub stehen. Heu kann man – insbesondere für staubempfindliche Pferde – anfeuchten oder bedampfen, um Schwebeteilchen zu reduzieren. Oft hilft es auch, auf entstaubte Einstreu (wie entstaubte Späne oder Pellet-Einstreu) umzusteigen, damit weniger Reizstoffe in die Atemwege gelangen. Bei pollenallergischen Pferden ist das kniffliger, denn die Pollen fliegen überall. Man könnte versuchen, das Pferd während der höchsten Pollenflugzeiten (meist morgens und abends bei trockener Wetterlage) eher im Stall zu lassen und dafür tagsüber oder nach einem Regenfall auf die Koppel – denn Regen wäscht Pollen aus der Luft. Eine Nasennetze oder spezielle Pollenmasken fürs Pferd gibt es auch, die einen Teil der Allergene abfangen können, allerdings ist die Wirksamkeit individuell unterschiedlich.
Bei Insektenallergie heißt es: den Kontakt so gut es geht vermeiden. Eine Fliegendecke oder Ekzemerdecke mit engmaschigem Stoff kann dein Pferd vor den Mücken schützen, noch bevor es anfängt zu scheuern. Diese Decken sollten möglichst frühzeitig zum Einsatz kommen (oft schon im März/April), damit erst gar kein Teufelskreis aus Juckreiz und Wunden entsteht. Fliegenmasken schützen die Augen und teilweise auch die Nüstern vor Insekten – viele Pferde tragen sie im Frühjahr und Sommer problemlo】. Achte darauf, dass die Maske gut sitzt und keine Scheuerstellen verursacht. Außerdem kannst du mit Insektenschutzmitteln (Repellents) arbeiten, um Fliegen und Mücken fernzuhalten. Hier gibt es Sprays, Gels oder auch biologische Ansätze wie Knoblauch im Futter (wobei dessen Wirkung umstritten ist). Wichtig ist, dass du die Mittel regelmäßig anwendest, vor allem in den Dämmerungszeiten, wenn die kleinen Mücken am aktivsten sind.
Manche Pferde entwickeln im Frühjahr Nesselfieber (Urtikaria) – plötzlich treten überall Quaddeln auf der Haut auf. Das kann allergisch bedingt sein, aber auch durch Temperaturwechsel (Kalt-Warm) ausgelöst werden. In jedem Fall ist es ratsam, bei starken allergischen Reaktionen oder anhaltenden Atemproblemen den Tierarzt hinzuzuziehen. Es gibt medikamentöse Hilfen wie Antihistaminika oder in schweren Fällen sogar Kortison, um akute Allergieschübe zu lindern. Ebenso können naturheilkundliche Ansätze (z.B. Schwarzkümmelöl bei Atemwegsproblemen, Aloe Vera bei Hautreaktionen) in Absprache mit dem Fachmann ausprobiert werden.
Nicht zuletzt: Pferdehusten im Frühjahr kann auch auf Infekte zurückgehen, da Viren und Bakterien natürlich ebenfalls unterwegs sind. Wenn dein Pferd hustet, schau also genau hin, ob es „nur“ an Pollen liegt oder ob eine Erkältung dahintersteckt. In jedem Fall ist jetzt die ideale Zeit, um die Abwehrkräfte deines Pferdes zu stärken – sei es durch ausgewogene Fütterung, ggf. immunstärkende Kräuter oder einfach durch viel Bewegung an der frischen Luft, was die Lungen frei hält.
Verhalten und Energielevel: Frühlingsgefühle beim Pferd
Der Frühling bringt nicht nur äußere Veränderungen, sondern wirkt auch stark auf das Gemüt unserer Pferde. Viele Reiter scherzen über die “Freuden der ersten Ausritte im Frühjahr”, wenn das normalerweise brave Pferd plötzlich jeden Busch zum Monster erklärt und in übermütige Bocksprünge verfällt. Tatsächlich steckt Wissenschaft dahinter: Die steigende Tageslichtmenge und die wärmenden Sonnenstrahlen beeinflussen den Hormonhaushalt der Pferde. Mit den längeren Tagen schüttet der Körper weniger Melatonin (Schlafhormon) aus und dafür mehr Serotonin, bekannt als *“Glückshormon”. Ein hoher Serotoninspiegel in Kombination mit sinkendem Melatonin sagt dem Pferdekörper: „Es ist Aktivitätszeit, ich fühle mich wach und gut gelaunt. Gleichzeitig kurbelt die angenehme Temperatur (~5–15 °C, das Wohlfühlklima für Pferde) den Kreislauf und die Durchblutung an.
Kurz: Unsere Pferde tanken Energie und Lebensfreude. Nach dem grauen Winter verspüren sie ähnlich wie wir Menschen einen richtigen Energieschub und das Bedürfnis, sich zu bewegen. Kein Wunder also, wenn dein Pferd im Frühling mal etwas “lustig” drauf ist!
Hinzu kommen Urinstinkte, die der Frühling weckt. In freier Wildbahn beginnt jetzt eine reiche Nahrungszeit – das wissen die Pferde instinktiv (man beobachtet oft, wie sie regelrecht Vorfreude auf saftiges Gras entwickeln, wenn sie die ersten grünen Halme sehen. Außerdem steht die Paarungszeit an: Stuten kommen vermehrt in Rosse, Hengste und auch Wallache können vom Fortpflanzungstriebbeeinflusst werden. Rangordnungsspiele und erhöhter Spieltrieb in der Herde sind jetzt normal. Dein Pferd muss also eine Menge Frühlingsgefühle verarbeiten!
Für uns Reiter und Halter heißt das: verständnisvoll und mit Humor, aber auch mit Umsicht damit umgehen. Freue dich, dass dein Pferd sich gut fühlt – sein Übermut zeigt ja, dass es gesund ist und der Frühling es beflügelt. Dennoch solltest du jetzt besonders auf Sicherheit und Training achten. Pferde, die über Winter vielleicht weniger gearbeitet wurden, haben nun überschüssige Energie. Es empfiehlt sich, ihnen diese Energie kontrolliert abbauen zu lassen, bevor du große Anforderungen stellst. Zum Beispiel könntest du dein Pferd vor dem ersten Ausritt auf dem Platz freilaufen lassen oder leicht longieren, damit es ein paar Bocksprünge machen und Dampf ablassen kann. Viele “Gehüpfe” passieren nämlich aus purer Freude und Bewegungsdrang – wenn das Pferd sich austoben durfte, ist es unter dem Sattel oft wieder viel konzentrierter. Gerade den ersten Geländeritt des Jahres unternimmst du am besten nicht alleine. Schnapp dir eine ruhige Handpferde-Begleitung oder geh anfangs eine Runde zu Fuß neben deinem Pferd, um zu sehen, wie es reagiert. Die Welt draußen ist jetzt voller neuer Reize (raschelnde Büsche, Tiere im Frühlingsmodus, bunte Drachen am Himmel?) – das bietet viel Potenzial zum Erschrecken oder Übermütigsein. Bleib also lieber auf der sicheren Seite, bis ihr beide wieder im “Draußen-Rhythmus” seid.

Auch auf dem Reitplatz merken viele: Das Pferd hat „Hummeln im Hintern“. Statt dagegen anzukämpfen, bau vermehrt Abwechslung und Denksport ins Training ein. Übergänge, Stangenarbeit, neue Lektionen – Hauptsache der Pferdekopf wird beschäftigt, damit die überschüssige Energie kanalisiert wird. Konsequent bleiben ist wichtig: Lass dein Pferd trotz aller Freude nicht einfach lostraben, wann es will, oder bocken, ohne dass es Konsequenzen hat. Gehorsamsübungen und klare Regeln geben dem Pferd Halt und erinnern es an die Manieren. Viele Pferde finden bei konsequenter, abwechslungsreicher Arbeit schnell zurück zur Arbeitsmoral, auch wenn sie anfangs rumalbern. Denk daran, nach einer Winterpause auch dein Training moderat zu steigern – nicht nur der Kopf, auch die Muskeln müssen sich wieder ans volle Pensum gewöhnen.
Ein Wort noch zu den rossigen Stuten: Im Frühling setzen bei vielen Stuten verstärkt die Rossezyklen ein, was mitunter launisches oder abgelenktes Verhalten erklären kann. Hab ein Auge darauf, ob deine Stute vielleicht gerade rossig ist, wenn sie ungewöhnlich kitzelig am Bauch, schmusig gegenüber Wallachen oder zickig beim Reiten ist. Hier hilft manchmal schon Verständnis (und an besonders heftigen Tagen etwas leichtere Arbeit), in manchen Fällen können Mönchspfeffer oder andere Ergänzungen das Rosse-Verhalten mildern. Bei Wallachen und Hengsten kann der Frühling ebenfalls die Hormone wecken – Wallache erinnern sich manchmal kurz daran, dass sie Männer sind, und Hengste haben natürlich ihren eigenen Kopf in der Decksaison. In solchen Fällen ist ruhiges, bestimmtes Handling gefragt, eventuell räumliche Trennung von Stuten, falls nötig, und einfach Zeit – nach ein paar Wochen normalisiert sich das meist.
Insgesamt gilt: Freu dich über ein quirliges Pferd im Frühling! Seine Lebensgeister sind geweckt. Mit etwas Management – viel Bewegung, frische Luft, geduldiges Training – wird aus der überschüssigen Energie schnell positive Energie, die ihr für sportliche Fortschritte oder gemeinsame Abenteuer nutzen könnt. Spring ist the time for new beginnings, auch im Sattel!
Praktische Tipps für die Frühlingszeit
Zum Abschluss haben wir die wichtigsten praxisnahen Tipps noch einmal übersichtlich zusammengestellt. So bereitest du dein Pferd optimal auf die Frühlingsmonate vor und meisterst typische Herausforderungen mit Links:
-
Schrittweises Anweiden: Plane einen genauen Weide-Eingewöhnungsplan. Beginne mit nur wenigen Minuten Gras am Tag und steigere die Weidezeit über mehrere Wochen langsam. Füttere Heu vor dem Weidegang, damit dein Pferd nicht in Windeseile zu viel Gras frisst. So beugst du Verdauungsproblemen und Hufrehe effektiv vor.
-
Fellwechsel unterstützen: Rüste dich mit Striegel, Kardätsche und eventuell einem Federstriegel oder Grooming-Glove aus – tägliches kräftiges Putzen hilft deinem Pferd, das Winterfell abzuwerfen. Achte auf Haut und Fellqualität: Bei trockenem, schuppigem Fell kann ein Schuss Öl im Futter oder ein Leinöl-Leckstein helfen, essenzielle Fettsäuren bereitzustellen. Bürste auch die empfindlichen Stellen (unter der Mähne, am Bauch) sanft, um Juckreiz zu lindern. Ältere Pferde freuen sich über ein bisschen extra Wärme in kalten Nächten, wenn sie schon im dünnen Fell dastehen.
-
Ernährung anpassen: Überprüfe die Kraftfuttermenge – braucht dein Pferd wirklich noch dieselbe Energiezufuhr wie im Winter, jetzt wo das Gras nahrhafter wird? Wahrscheinlich kannst du Stärke und Zucker reduzieren, um Gewichtszunahme zu vermeiden. Wichtig ist aber, dass weiterhin genug Raufutter verfügbar ist: lieber etwas Heu übrig lassen, als dass dein Pferd Hunger schiebt. Stelle sicher, dass ein Minerallickstein immer erreichbar ist, um Mikronährstoffe abzudecken. Falls dein Pferd zu Durchfall neigt, können Magen-Darm-Kräuter oder ein Joghurt/Kefir-Mash (für Probiotika) hilfreich sein – besprich solche Zusätze aber am besten mit einem Fütterungsexperten.
-
Huf- und Weidemanagement: Kontrolliere im Frühling häufiger die Hufe deines Pferdes. Durch wechselndes Wetter können Probleme wie Strahlfäule (in matschigem Boden) oder trockene, rissige Hufe (bei plötzlicher Wärme) auftreten. Pflege die Hufe mit geeignetem Hufpflegemittel je nach Bedarf (fettend bei Nässe, feuchtigkeitsspendend bei Trockenheit). Prüfe die Weidezäune, bevor die Saison losgeht, und repariere kaputte Stellen – frische Frühjahrsenergie könnte dein Pferd sonst zu unerwünschten Erkundungstouren verleiten. Stelle auch sicher, dass Tränken und Wasserstellen sauber sind; Algen lieben die ersten warmen Tage.
-
Allergieprophylaxe: Kennst du die Allergien deines Pferdes, beginne früh mit Gegenmaßnahmen. Bei Sommerekzem-Pferden: Decke und Maske rechtzeitig auf, bevor die ersten Mücken schwärmen. Halte eine Juckreiz-Salbe (z.B. Zinksalbe oder spez. Ekzemlotion oder unsere Zeolith-Wundsalbe) bereit, um kleine gereizte Stellen sofort zu versorgen. Bei staubempfindlichen Pferden: Mach jetzt den Stall frühjahrsfit – Entrümple alte Heuballen, die schimmeln könnten, und wähle frisches, gutes Heu. Lüfte viel, vor allem beim Ausmisten, und ziehe in Erwägung, Heu zu bedampfen. Denke auch an die Impfungen: Viele Impfpläne sehen im Frühjahr Auffrischungen vor – check den Pass, ob etwas fällig ist, um auch Infektionskrankheiten vorzubeugen.
-
Frühlings-Fitnessprogramm: Nimm die neu gewonnene Energie deines Pferdes als Ansporn für euer Training. Plane abwechslungsreiche Einheiten – vielleicht mal einen kleinen Springparcours im Gelände aufbauen, einen Trail-Parcours basteln oder neue Dressurlektionen üben. So bleibt der Kopf deines Pferdes bei dir. Wenn es sehr übermütig ist, scheue dich nicht, kurz zu longieren, bevor du aufsitzt. Sicherheit geht vor, und es spricht nichts dagegen, dass dein Pferd sich zuerst ohne Reiter austoben darf. Organisiere gemeinsame Ausritte mit Stallkameraden; in der Gruppe fühlen sich viele Pferde sicherer, und du hast Unterstützung, falls doch ein Hüpfer kommt. Denke auch an deine eigene Fitness – nach der Winterpause langsam wieder Kondition aufbauen, dann könnt ihr den Frühling sportlich richtig genießen.
Mit diesen Tipps kommst du und dein Pferd gut gewappnet durch die Frühjahrssaison. Die Balance aus Vorsicht und Genuss ist der Schlüssel: Erlaube deinem Pferd das Frühjahrsglück, aber habe stets ein wachsames Auge auf seine Gesundheit.
Reflexionsfragen für PferdehalterInnen
Zum Abschluss ein paar Fragen zum Nachdenken: Gehe einmal in dich und beantworte für dich selbst ehrlich, wie du und dein Pferd im Frühling aufgestellt sind. Anhand dieser Fragen kannst du herausfinden, ob es noch etwas zu verbessern gibt oder ob du schon auf dem richtigen Weg bist:
- Fütterungsplan – Habe ich den Futterplan meines Pferdes an die Frühlingsbedingungen angepasst? (z.B. schrittweises Anweiden, Anpassung der Kraftfuttermenge, Mineralstoffversorgung gesichert)
- Fellwechsel-Unterstützung – Wie helfe ich meinem Pferd aktuell durch den Fellwechsel? Nutze ich regelmäßige Pflege und eventuell Futterzusätze, um ihm den Haarwechsel zu erleichtern?
- Weidemanagement – Habe ich einen konkreten Plan fürs Anweiden und die Weidezeit? Kenne ich die Risiken (Kolik, Hufrehe) und tue ich genug, um vorzubeugen (langsame Steigerung, Heufütterung vorher, Beobachtung meines Pferdes auf Anzeichen von Unverträglichkeiten)?
- Allergien & Atemwege – Bin ich vorbereitet, falls mein Pferd allergisch reagiert? Welche Maßnahmen habe ich für den Fall von Frühjahrsallergien parat (z.B. Fliegenschutz, staubarmes Management, tierärztliche Abklärung bei chronischem Husten)?
- Verhalten & Training – Wie gehe ich mit dem Energieüberschuss meines Pferdes um? Habe ich einen Plan, um meinem Pferd genug Auslauf und Beschäftigung zu bieten, damit es ausgeglichen bleibt? Bin ich selbst mental darauf eingestellt, gelassen und konsequent mit möglichen „Frühlingsbucklern“ umzugehen?
- Gesamtmanagement – Gibt es weitere Frühlingsthemen, die ich beachten sollte? (Etwa Hufpflege, Impf- und Entwurmungsintervalle, Weidepflege, Equipment-Check – passt der Sattel noch, wenn das Winterfell ab ist und die Muskulatur sich verändert?)
Nimm dir Zeit, diese Fragen ehrlich zu beantworten. Der Frühling ist eine Übergangszeit, in der man viel richtig machen kann – aber auch einiges falsch, wenn man unvorbereitet ist. Je besser du die Bedürfnisse deines Pferdes in dieser Jahreszeit kennst, desto wohler und gesünder wird es durch den Frühling kommen. Und das schönste Ergebnis ist doch ein zufriedenes, glänzendes Pferd, das voller Lebensfreude mit dir in die warme Jahreszeit startet. In diesem Sinne: Genießt den Frühling und lasst es euch gut gehen – es ist die Zeit der Erneuerung und des Aufblühens, für Mensch und Tier gleichermaßen!

Zeolith als natürliche Unterstützung für Pferde im Frühling
Zeolith kann Pferden im Frühling auf verschiedene Weise helfen, die Herausforderungen dieser Jahreszeit besser zu meistern. Dank seiner einzigartigen adsorptiven, entgiftenden und mineralstoffreichen Eigenschaften unterstützt es den Organismus in mehreren Bereichen:
1. Unterstützung beim Fellwechsel
- Der Fellwechsel belastet den Stoffwechsel und benötigt eine erhöhte Mineralstoff- und Spurenelementzufuhr.
- Zeolith kann helfen, den Körper zu entlasten, indem es Schwermetalle, Stoffwechselrückstände und überschüssige Säuren bindet.
- Dadurch kann der Körper Nährstoffe besser verwerten, was sich positiv auf Haut, Fell und das Immunsystemauswirkt.
2. Darmgesundheit & Fütterungsanpassung.
Der Wechsel von Heu auf frisches Gras stellt eine Herausforderung für die Darmflora dar.
- Zeolith kann helfen, Übersäuerung im Darm zu regulieren, Schadstoffe zu binden und die Darmflora zu stabilisieren.
- Dadurch kann es Verdauungsprobleme wie Kotwasser, Durchfall oder Blähungen reduzieren und den Übergang auf Weidegras erleichtern.
3. Schutz vor Hufrehe und Stoffwechselentlastung

Frühlingsgras enthält oft hohe Mengen an Fruktan und Zucker, was das Risiko für Stoffwechselprobleme wie Hufrehe erhöht.
- Zeolith kann überschüssige Stoffwechselprodukte binden, den pH-Wert regulieren und so zur Entlastung der Leber und Niere beitragen.
- Eine regelmäßige Gabe kann helfen, den Stoffwechsel stabil zu halten und das Risiko für Stoffwechselkrankheiten zu reduzieren.
4. Unterstützung des Immunsystems bei Allergien & Atemwegsproblemen
Pollen, Schimmelsporen und Staub können im Frühjahr Allergien und Atemwegsprobleme verschärfen.
- Zeolith kann helfen, Toxine und allergieauslösende Stoffe im Darm zu binden, wodurch der Körper entlastet wird und das Immunsystem gestärkt bleibt.
- Einige Pferdehalter berichten von positiven Effekten bei allergischen Reaktionen wie Sommerekzem und Atemwegsreizungen.
5. Mehr Energie & Wohlbefinden durch Entgiftung
Der Wechsel der Jahreszeit kann Pferde müde oder träge machen.

- Eine regelmäßige Gabe von Zeolith unterstützt die Entgiftung des Körpers, was zu mehr Vitalität und Leistungsbereitschaft führen kann.
- Gleichzeitig kann es helfen, Muskelverspannungen zu reduzieren, indem es den Säure-Basen-Haushalt reguliert.
Dosierung & Anwendung
- Zeolith kann ins tägliche Kraftfutter oder Mash gemischt werden.
- Eine typische Dosierung für Pferde liegt bei 5–10 g pro 100 kg Körpergewicht täglich.
- Wichtig: Ausreichend Wasser bereitstellen, damit das Zeolith seine Wirkung optimal entfalten kann.
Fazit: Zeolith kann Pferde im Frühling auf natürliche Weise unterstützen – von Fellwechsel über Weideumstellung bis hin zur Stoffwechsel- und Immunsystem-Stärkung. Eine clevere Ergänzung für eine gesunde und energievolle Frühlingssaison!
Als Abschluss: Mit der Natur gehen – das Leben lieben & Erneuerung wertschätzen
Der Frühling ist eine Zeit des Aufbruchs, der Erneuerung und des Wandels – für die Natur ebenso wie für unsere Pferde. Wer mit der Natur geht, liebt das Leben und erkennt den Wert des stetigen Wandels. Die Veränderungen dieser Jahreszeit bringen Herausforderungen mit sich, doch wer sie frühzeitig erkennt und proaktiv handelt, macht aus ihnen eine Chance zur Stärkung und Entwicklung.
Challenge accepted! – Der kluge Pferdehalter sieht die Frühlings-Herausforderungen vorher, trifft rechtzeitig Vorkehrungen und sorgt für eine gesunde Anpassung seines Pferdes. Sei es durch vorausschauendes Anweidemanagement, gezielte Fellwechsel-Unterstützung oder achtsames Training, wir können den Übergang für unsere Pferde sanft und sicher gestalten.
Der Frühling lehrt uns: Erneuerung ist ein Geschenk – wir müssen sie nur achtsam begleiten, um sie in vollen Zügen genießen zu können.
Der ist jetzt doch recht lang geworden - hier noch eine Zusammenfassung für Schnellleser:
Zusammenfassung: Herausforderungen für Pferde im Frühling
Der Frühling bringt für Pferde und ihre Halter eine Mischung aus Freude und Herausforderungen. Während sich die Natur erneuert, müssen sich Pferde an veränderte Bedingungen anpassen – sowohl körperlich als auch mental.
1. Fellwechsel – Energieaufwand und Unterstützung
- Der Fellwechsel fordert den Stoffwechsel stark und kann ältere oder schwächere Pferde belasten.
- Tägliche Fellpflege und eine angepasste Ernährung mit Zink, Kupfer und Omega-3-Fettsäuren unterstützen das Wachstum des neuen Sommerfells.
- Pferde mit langsamem Fellwechsel sollten auf gesundheitliche Probleme wie Cushing überprüft werden.
2. Fütterung – Übergang von Heu zu Frühlingsgras
-
Frühlingsgras ist eiweiß- und zuckerreich, was das Verdauungssystem belasten kann.
- Schrittweise Umstellung ist entscheidend, um Verdauungsstörungen und Hufrehe zu vermeiden.
- Raufutter (Heu) sollte weiterhin gefüttert werden, um die Darmgesundheit zu unterstützen.
3. Weidegang – Risiken und Vorteile
- Der Übergang auf die Weide muss langsam erfolgen (Anweiden über mehrere Wochen).
- Ein plötzlicher Wechsel kann zu Koliken, Durchfall oder Hufrehe führen.
- Weidehygiene ist wichtig: Zäune kontrollieren, giftige Pflanzen entfernen, Tränken säubern.
4. Allergien und Atemwegsprobleme
- Pollen, Schimmelsporen und Insekten können allergische Reaktionen oder Atemprobleme verursachen.
- Prävention: Fliegendecken, Nasennetze, entstaubtes Heu und gute Stallbelüftung.
- Ekzemerpferde sollten frühzeitig mit Schutzmaßnahmen versorgt werden.
5. Verhalten & Energielevel – Frühlingsgefühle im Pferdekörper
- Längere Tage und mildes Wetter beeinflussen den Hormonhaushalt und führen oft zu mehr Energie und Spielfreude.
- Sicherheit im Training: Pferde langsam an die Saison gewöhnen, ggf. an der Longe auspowern lassen.
- Harmonie statt Stress: Klare Regeln und abwechslungsreiches Training helfen, den Frühling bestmöglich zu nutzen.
Praktische Tipps für Pferdehalter
✅ Anweiden langsam steigern, beginnend mit 15 Minuten pro Tag
✅ Fellwechsel mit Pflege und Mineralien unterstützen
✅ Weidegänge überwachen und Futter schrittweise anpassen
✅ Allergien frühzeitig vorbeugen (z.B. durch Insektenschutz und Pollenmanagement)
✅ Training anpassen und auf überschüssige Energie achten
Reflexionsfragen für PferdebesitzerInnen
- Habe ich meinen Futterplan an den Frühling angepasst?
- Unterstütze ich mein Pferd im Fellwechsel optimal?
- Plane ich das Anweiden schrittweise und kontrolliert?
- Bin ich auf mögliche Allergien und Atemprobleme vorbereitet?
- Berücksichtige ich die steigende Energie meines Pferdes im Training?
Mit der richtigen Balance aus Vorsicht und Freude wird der Frühling für dein Pferd zur gesunden und glücklichen Jahreszeit!
👉 Hier findest du das Produkt des Monats und einen guten Überblick über alle Bereichevon STEINKRAFT
👉 Hier findest du alle STEINKRAFT Produkte auf einen Blick - direkt im Shop